63
Glauchau - Glaukom
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gläubigerversammlung'
Anmerkung: Fortsetzung von [Österr. Konkursordnung.]
zu verwenden». Der «Masseverwalter», der nach §. 76 Vertreter der Gläubigerschaft
ist, steht zu dieser, die ihm auch (nach §. 144), sobald die allgemeine
Liquidierungstagfahrt stattgefunden hat,
«besondere Verhaltungsnormen zur Richtschnur vorzeichnen»
kann, in einem etwas andern Verhältnis als der deutsche Konkursverwalter zur G. und zum
Gläubigerausschuß
(s.d.). Die Gläubigerschaft kann hier auch von dem erwähnten Zeitpunkte an
ohne weiteres an Stelle des vom Gericht ernannten Masseverwalters einen
andern bestellen, der in ihrem Namen die Geschäfte führt.
Glauchau
. 1)
Amtshauptmannschaft
in der sächs. Kreishauptmannschaft Zwickau, hat
316,05 qkm, (1890) 137 709 (67 284 männl., 70425 weibl.) E.
in 7 Städten und 77 Landgemeinden. -
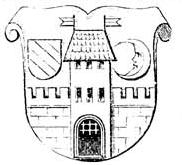
Textfigur:
2)
Hauptstadt
der Amtshauptmannschaft G., 11 km nördlich von Zwickau, 27 km westlich von Chemnitz,
in etwa 264 m Höhe, teils im Thale, teils an den ansteigenden Höhen an der Zwickauer Mulde
und den Linien Görlitz - Dresden - Reichenbach, G.-Großbothen (56,8 km)
und Gera-Gößnitz-G. (51,4km) der Sächs. Staatsbahnen,
ist Sitz der königl. Amtshauptmannschaft, eines Amtsgerichts (LandgerichtZwickau)
mit Kammer für Handelssachen, Untersteueramtes, einer Bezirksschulinspektion und
Bezirkssteuereinnahme, der gräfl. Schönburgischen Gesamtkanzlei (s.
Schönburg
)
, einer Reichsbanknebenstelle sowie einer Superintendentur, hatte
1834: 6292, 1858: 14 357, 1890: 23 405 (11 532 männl., 11 873 weibl.) E.,
darunter 463 Katholiken und 24 Israeliten, Post erster Klasse mit Zweigstelle,
Telegraph, Fernsprechamt, Georgskirche in Kreuzform (1104), Gottesackerkirche (1581),
Schloß Forderglauchau, 1527-34 von Ernst von Schönburg errichtet,
1603 verändert, Schloß Hinterglauchau, 1460-70 erbaut, 1764 erneuert,
mit Kapelle (1490), ein Rathaus, 1819 an Stelle des abgebrannten erbaut,
und Stadthaus; eine Realschule mit Progymnasium, höhere Webschule
(mit berühmter Sammlung alter Webstoffe), je eine kaufmännische,
gewerbliche und allgemeine Fortbildungsschule, einen Gewerbe- und Pädagogischen Verein,
zwei Freimauererlogen; Männerhospital, Kranken-, Waisenhaus, 2 Frauenhospitäler
und zahlreiche Vereine für wohlthätige Zwecke. G. ist für die Fabrikation
von wollenen und halbwollenen Stoffen einer der wichtigsten Plätze von ganz Deutschland.
Es bestehen 9 mechan. Webereien (Damenkleiderstoffe) mit bedeutendem Export,
25 Färbereien, Appreturanstalten, Garnwäschereien und -Druckereien, 2 Spinnereien,
mehrere Musterzeichnereien und Jacquardkartenschlägereien, eine
Jacquardmaschinen- und Webutensilienfabrik, ferner Eisengießereien und Maschinenfabriken,
Mahl- und Sägemühlen, Bierbrauereien, Ziegeleien. In G. wurde 1490 der berühmte Mineralog
Georg Agricola
(s. d.) geboren. G. war Sitz der Grafen von Schönburg, wurde 1430 von den
Hussiten erobert und mehrmals durch Feuersbrünste verwüstet. 1542 wurde in G.
die Reformation eingeführt. - Vgl. Eckardt, Chronik von G. (Glauchau 1882).
Glauke
, d. h. Glänzende, oder
Krëusa, Tochter des KönigsKreon von Korinth, s.
Medeia
. - G. heißt auch der 238. Planetoid.
↔
Glaukodōt
, ein rhombisches, dem Arsenkies sehr ähnlich krystallisierendes Mineral von dunkel
zinnweißer Farbe, chemisch mit dem regulären eisenreichern
Glanzkobalt
(s. d.) identisch, weshalb diese Kobaltverbindung dimorph ist;
er findet sich bei Håkansbo in Schweden sowie in Chile.
>
Glaukom
(grch.) oder
Grüner Star (Glaucoma), eine der gefährlichsten Augenkrankheiten, die, sich selbst überlassen, unter plötzlich
oder langsam sich entwickelnder Sehschwäche und periodisch auftretenden Anfällen voll
Nebelsehen schließlich zu völliger Erblindung führt. Die Ursache der Krankheit,
deren Erkennung erst durch den Augenspiegel ermöglicht wurde, besteht in einer
abnormen Drucksteigerung im Innern des Augapfels infolge einer Vermehrung der
Augenflüssigkeiten (Glaskörperflüssigkeit, Kammerwasser); diese intraokulare
Drucksteigerung wird aber dadurch verhängnisvoll, daß durch sie die zarten Fasern
des Sehnerven sowie der lichtempfindenden Netzhaut eine widernatürliche Zerrung und
Quetschung erfahren und schließlich durch Atrophie zu Grunde gehen. Bei der äußern
Untersuchung fühlt sich ein solches glaukomatöses Auge weit fester und härter an,
als ein normales, bisweilen selbst steinhart, die Pupille erscheint starr und erweitert,
der Augenhintergrund von meer- oder bouteillengrüner Farbe (daher auch der Name Grüner Star);
bei der ophthalmoskopischen Untersuchung sieht man die Papille oder Eintrittsstelle des
Sehnerven infolge der Patholog. Drucksteigerung tief ausgehöhlt (sog.
Exkavation des Sehnerven). Häufig verläuft der glaukomatöse Prozeß ohne jedwede
entzündliche Erscheinungen (einfaches G.,
Glaucoma simplex); in andern Fällen ist eine gleichzeitige Entzündung vorhanden (
entzündliches G.,Glaucoma inflammatorium).
Der gewöhnliche Verlauf des Grünen Stars ist der, daß der Kranke zunächst eine
auffallend rasch zunehmende Fernsichtigkeit an sich beobachtet, die ihn beim
Lesen zur Benutzung immer stärkerer Brillen veranlaßt, und daß sich hierzu
eigentümliche periodische Anfälle von Nebelsehen gesellen, wobei alle Gegenstände
wie in einen dichten Nebel gehüllt erscheinen; häufig ist auch
Regenbogensehen
(s.d.) vorhanden. Nicht selten stellen sich heftige Schmerzen im Augapfel,
in der Stirn über dem Auge und in der ganzen Kopfhälfte auf der Seite des befallenen Auges,
mitunter auch heftiges Erbrechen ein. Diese Anfälle von Nebelsehen gehen gewöhnlich anfangs rasch vorüber, kehren
aber über lang oder kurz wieder und hinterlassen eine sichtliche Abnahme des Sehvermögens und eine ganz
eigentümliche Beschränkung des Gesichtsfeldes, die fast immer an der Nasenseite beginnt und sich von da
immer weiter verbreitet, so daß das Sehfeld endlich nur noch die Gestalt eines schmalen Spaltes besitzt,
bis auch das centrale Sehen erlischt und vollkommene Erblindung eintritt. Bei heftiger glaukomatöser
Entzündung kann es schon in wenigen Wochen(Glaucoma acutum), ja sogar binnen wenigen Tagen, selbst Stunden
zur Erblindung kommen (Glaucoma fulminans). Auch nach Vernichtung des Sehvermögens kann der glaukomatöse Prozeß noch fortdauern und
tiefgreifende Veränderungen und Schrumpfungen des Augapfels herbeiführen. Oft werden beide Augen
kurz nacheinander vom G. ergriffen.
Das G. tritt am häufigsten nach dem 50. Lebensjahre auf, kommt bei Frauen etwas häufiger als bei Männern vor und befällt mit einer gewissen Vor-
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 64.
