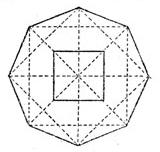91
Achteck - Achtyrka.
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Acht'
Störung und durch Leistung der nötigen Entschädigung oder Buße sich mit dem Ankläger und dem verletzten
Verein wieder auszusöhnen. Das Recht zu solcher feierlicher Aufforderung wie die Ausübung oder jenes
Auffordern und Vorladen selbst hieß Bann im weitesten Sinn und stand seit Ausbildung der königlichen
Macht den Königen und den von diesen damit bevollmächtigten Gerichten zu. Wenn auf dreimalige, je eine
sächsische Frist (6 Wochen und 3 Tage) haltende Vorladung der Angeklagte sich nicht stellte oder die
aufgegebene Buße nicht leistete, so traf ihn die Unteracht, d. h.
sein Vermögen wurde mit Beschlag belegt, und bei Strafe durfte ihn niemand im Bannbezirk aufnehmen und
unterstützen, der Ankläger aber durfte ihn ergreifen und vor Gericht stellen. Wenn er nun Jahr und Tag
(1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tage) in diesem Bann blieb, ohne die nötige Buße zu leisten, so wurde vom König
die Oberacht (Aberacht), der
Königsbann, d. h. die völlige Fried- und Rechtlos- oder Vogelfreierklärung, gegen ihn ausgesprochen und
dies durch den Achtbrief bekannt gemacht. Erschien der
Geächtete oder Verfestete später,
wozu er sicheres Geleit auswirken mußte, und bewies er seine Unschuld, so wurde er zwar freigesprochen,
mußte aber dem Gericht eine bestimmte Summe (Achtschätzung) zahlen. Reichsacht
wurde die A. genannt, welche sich über das ganze Reich, Landacht die,
welche sich nur über den Bezirk eines gewissen kaiserlichen oder reichsständischen Landgerichts erstreckte.
Das rechtliche Verfahren, welches den Ausspruch von Bann und A. bedingte, hieß der
Achtsprozeß, zu dessen eigentümlichen Formen es gehörte, daß die A.
nur unter freiem Himmel ausgesprochen wurde. Viele hierauf bezügliche Bestimmungen erlitten im Lauf der
Zeiten bedeutende Abänderungen. Wenn z. B. die Oberacht ursprünglich nur vom König oder vom Kaiser an der
Spitze des Reichstags oder des Gerichts der fürstlichen und gräflichen Standesgenossen (der Reichsfürsten
und Reichsgrafen) ausgesprochen werden sollte, so verletzten doch einzelne, wie Karl V. bei der Ächtung
des Landgrafen Philipp von Hessen und des Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen, Ferdinand II. dem Kurfürsten
Friedrich V. von der Pfalz gegenüber, die gesetzliche Form und umgingen Reichstag und Fürstengericht. Nach
der Einrichtung des Reichskammergerichts sprach dieses oftmals die A. aus, seit dem Westfälischen Frieden
der Kaiser mit Zuziehung des an die Stelle des Fürstengerichts getretenen Reichshofrats, und endlich
bestimmte die ständige Wahlkapitulation von 1711 (Art. 20), daß eine Ächtung gegen Reichsstände von einem
der höchsten Reichsgerichte instruiert, sodann von einer besondern Reichsdeputation begutachtet und durch
den Reichstag genehmigt werden müsse. Die letzten Achtserklärungen waren 1706 die gegen den Kurfürsten
Maximilian II. Emanuel und dessen Bruder, den Kurfürsten von Köln, welche auch nach dem 1702 an Frankreich
erklärten Reichskrieg Bundesgenossen dieser Macht blieben. Gegen den freien, nicht reichsunmittelbaren Bürger
aber war das Achtverfahren außer Anwendung gekommen, seitdem die Idee des freien Friedensvereins deutscher
Männer dem Begriff der Unterthanschaft unter der regierenden Herrschaft Platz gemacht hatte.
Achteck (Oktagon, Oktogon),
in der Stereometrie ein Körper mit acht Ecken oder Winkeln.
Achtender (Achter),
s. Geweih.
Achter, der plattdeutsche Ausdruck für die veraltete Präposition "after",
d. h. hinter; also z. B. Achtersteven, s. v. w. Hintersteven, und Achterdeck;
s. Schiff.
↔
Achterfeldt, Johann Heinrich, kath. Theolog, geb. 17. Juni
1788 zu Wesel, ward 1818 Professor in Braunsberg, 1826 in Bonn, 1844 als Anhänger der vom römischen Stuhl als Irrlehre
verworfenen Lehre des Hermes (s. d.), dessen "Christkatholische Dogmatik" er herausgab, vom
Erzbischof von Köln suspendiert. Mit seinem Gesinnungsgenossen Braun gab er 1843-48 die "Zeitschrift für Philosophie
u. katholische Theologie" heraus. Er starb 11. Mai 1877 in Bonn.
Achtermann, Wilhelm, deutscher Bildhauer, geb. 15. Aug. 1799
in einem Dorf bei Münster, erlernte das Schreinerhandwerk und lieferte Schnitzereien, die wegen ihrer Feinheit und
Zierlichkeit bewundert wurden. Schon 32 Jahre alt und ohne alle Vorbildung widmete er sich der Kunst. In Berlin, wohin
er sich zu seiner Ausbildung begab, arbeitete er in den Ateliers von Rauch und Tieck. Durch Verkauf kleiner Arbeiten
verschaffte er sich endlich die Mittel zu einer Reise nach Italien. In Rom verfertigte er eine Pietà, die sich jetzt im
Dom von Münster befindet und in kleinern Nachbildungen verbreitet ist. Sein umfangreichstes Werk ist eine aus fünf
überlebensgroßen Figuren bestehende Kreuzabnahme von karrarischem Marmor, die 1858 im Dom zu Münster aufgestellt wurde.
Seine letzte größere Arbeit war ein gotischer Altar mit drei Reliefs aus dem Leben Christi für den Dom zu Prag (1873
aufgestellt). Obwohl A. einen großen Reichtum der Empfindung besaß, gelang es ihm bei seiner mangelhaften Formenkenntnis
nicht, in das Wesen der plastischen Kunst einzudringen. Er starb 26. Mai 1884 in Rom, wo er seit 1839 fast ununterbrochen
seinen Wohnsitz hatte.
Achtermannshöhe, ein Gipfel des Harzes, südlich vom Brocken, bildet einen mit prächtigem
Laub- und Nadelholz bewaldeten Granitkegel von 924 m Höhe.
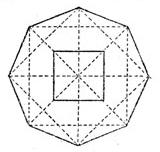
Textfigur: Achtort.
Achtort, ein achtspitziger, aus zwei sich durchkreuzenden Quadraten gebildeter Stern (s.
die punktierten Quadrate der Figur), war in der gotischen Architektur des Mittelalters eine zum Entwurf der Grundrisse
für Türme, Pfeiler, Fialen u. dgl. wichtige Figur.
Achtuba, Mündungsarm der Wolga, der sich oberhalb Zarizyn links abzweigt und sich unweit des
Meers mit dem Bereket vereinigt, dessen Namen er dann annimmt (s. Wolga).
Achtung, das Gefühl, welches aus der Voraussetzung des persönlichen Werts, sei es bei sich
(Selbstachtung), sei es bei andern (A. andrer), entspringt. Gegenteil derselben ist die Verachtung, das Gefühl, welches
der Voraussetzung persönlichen Unwerts bei sich selbst (Selbstverachtung) oder bei andern (Verachtung andrer) entstammt.
Verbindet sich die Selbstachtung mit der Verachtung andrer, so entsteht, wenn beide berechtigt sind, berechtigtes, sind
sie dagegen unberechtigt, unberechtigtes Selbstgefühl (Selbstüberhebung). Verbindet sich die Selbstverachtung mit der
A. andrer, so entsteht, wenn beide berechtigt sind, berechtigte, sind sie dagegen unberechtigt, unberechtigte Scheu
(Selbsterniedrigung). Verbindet sich mit der Voraussetzung des persönlichen Werts andrer die Vorstellung von dessen
unendlicher Überlegenheit, so geht die A. in Ehrfurcht (s. d.),
verknüpft sich die letztere mit der Voraussetzung persönlichen Unwerts, so geht die Verachtung in
Grauen (s. d.) über.
Achtyrka, Kreisstadt im kleinruss. Gouvernement Charkow, an zwei Flüssen, Achtyrka und Gussinza (zur
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 92.