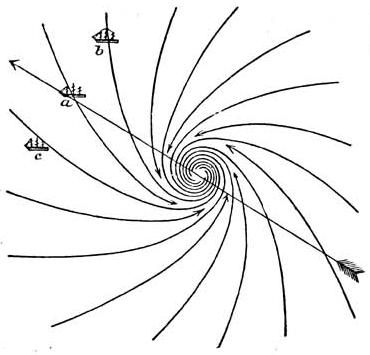560
Manövriergeschütze – Mansfeld (Stadt)
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Manövrieren im Wirbelsturm'
so ergiebt sich, daß für die nördl. Halbkugel die rechte, für die südliche die linke Seite eines
Wirbelsturms die gefährliche ist; denn ein Schiff in b (s. Abbildung) muß die Bahn des Centrums
vor diesem passieren, um, auf c zusteuernd, aus dem Gefahrbereich zu gelangen. Dreht das in b
befindliche Schiff
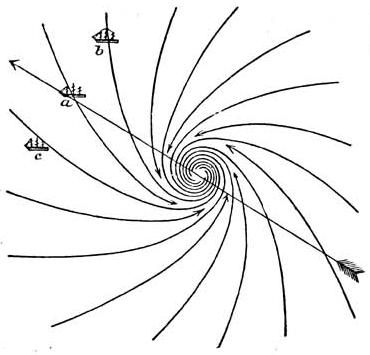
Textfigur:
bei (s. Beidrehen), so muß es sich darauf vorbereiten, den Orkan mit ganzer
Gewalt über sich ergehen zu lassen; um der Gefahr für den Verlust des Ruders und der Segel
hierbei vorzubeugen, muß das Schiff über Backbordbug beidrehen, weil auf der rechten Seite der
Orkanbahn der Wind über diesen Bug raumt (s. Raumen). Die vordere rechte
Seite (auf nördl. Halbkugel) wird dadurch noch gefährlicher, daß die Orkanbahnen im allgemeinen
die Tendenz haben, nach rechts hin sich zu krümmen. Ein in a befindliches Schiff wird sich durch
Abhalten nach c hin schützen können. Die linke Seite wird die navigierbare genannt, ein in c
befindliches Schiff wird durch Abhalten oder Beidrehen über Steuerbordbug dem Centrum fern genug
bleiben können. Das Abhalten (Lenzen, s.d.) darf nie platt vor dem Winde
geschehen, da die spiralförmig gekrümmten Windrichtungen zeigen, daß dann stets Gefahr der
Annäherung an das Centrum vorhanden ist. - Vgl. Segelhandbuch für den Atlantischen Ocean, hg.
von der Deutschen Seewarte (Hamb. 1885); Segelhandbuch für den Indischen Ocean, hg. von der
Deutschen Seewarte (ebd. 1892).
Manquieren, mankieren (frz.), fehlen,
mangeln, auch Bankrott machen, fallieren; Manquement
(spr. mangkmang), Mangel, Ausfall.
Manrēsa, Stadt in der span. Provinz Barcelona, eine der
malerischsten Städte Cataloniens, links am Cardoner, Station der Eisenbahn Barcelona-Lerida und
M.-Berga, hat (1887) 22685 E., große Spinnereien und Tuchfabriken. In einer Höhle bei M. lebte eine
Zeit lang Loyola.
Mans, Le, Stadt in Frankreich,
s. Le Mans.
Mansa, der Wurzelstock von
Anemiopsis californica
Hook
., einer amerik. Piperacee, Heilmittel bei Malariafieber und Ruhr.
Mansarde
(frz.), Dachgeschoß, Dachstube.
Mansart
(Mansard, spr. mangsahr),
François, franz. Baumeister, geb. 1598 zu Paris, gest. daselbst im Sept. 1666. Seine
namhaftesten Bauten in Paris sind nicht mehr vorhanden oder durch Um- und Anbauten entstellt, z.
B. das Hôtel de Lavrillière zu Paris, jetzt die Französische Bank; das Hotel Carnavalet
daselbst, jetzt ein Museum für Altertümer. Doch zeigt sich M.s Kunst in dem schönen Schlosse
Maisons bei St. Germain-en-Laye, jetzt Maisons-Laffitte genannt. M. ist einer der feinsten und
anmutigsten unter den franz. Architekten, ein Künstler von oft klassischer Strenge im Detail; er
gewann großen Einfluß auf Deutschland, wohin die Hugenotten seine Kunstart trugen. Mit Unrecht
gilt er für den Erfinder der nach ihm benannten Mansardendächer (s. Dach und
Dachstuhl, Bd.4, S. 678 b), welche schon früher angewendet wurden, die aber von M. um
1650 wieder aufgebracht und allgemein beliebt gemacht wurden.
Jules Hardouin-Mansart, Neffe und Schüler des vorigen, geb.
1645 zu Paris, gest. 11. Mai 1708 zu Marly-le-Roi, war erster Hofbaumeister Ludwigs ⅩⅣ. und
Oberaufseher der königl. Bauten. Außer einer Anzahl von Schlössern in der Umgegend von Paris
baute er die Kapelle in Versailles und den Invalidendom zu Paris (1706; s. Tafel:
Pariser Bauten, Fig. 2). – Vgl. Gurlitt, Geschichte des Barockstils, des Rokoko und des Klassicismus (Stuttg. 1887‒89); Dohme, Jules Hardouin-Mansart (in «Kunst und Künstler», Heft
74, Lpz. 1880)
Manschette
(frz. manchette), ein selbständiges oder mit dem Ärmel
verbundenes Bekleidungsstück, entweder glatt aus steifer Leinwand oder als Ärmelkrause oder als
Spitzenmanschette gefertigt; letztere waren unter Ludwig ⅩⅣ. beliebt; auch die Papier- oder
Seidenhülle des Bouquets heißt M.; in der Technik ein aus weichem Metall (Kupfer) oder häufiger aus
Leder gebildeter Stulp, der zur Abdichtung einfacher Kolben (s. d.) gegen die
Cylinderwand dient (sog. Manschettendichtung).
Mansfeld, früher Grafschaft (1100 qkm) des Obersächsischen Kreises, zum
Reg.-Bez. Merseburg der preuß. Provinz Sachsen gehörig, ist gebirgig und hat ansehnlichen Berg- und Hüttenbau. Zum Gebiet der frühern Grafschaft gehören auch zwei Seen, der Salzige und der
Süße See (s. Salziger See). Städte sind M., Eisleben, Sangerhausen und Hettstedt.
Die Grafschaft wurde als Magdeburger, Halberstädter und kursächs. Lehn, nachdem sie wegen tiefer
Verschuldung der Grafen seit 1570 von den Lehnsherren und deren Nachfolgern teilweise bis 1716,
teilweise bis 1780 sequestriert worden war, in letztgedachtem Jahre beim Erlöschen des
Mannsstammes der Grafen von M. zwischen Preußen und Sachsen geteilt. Der preuß. Anteil wurde
1807, der sächsische größtenteils 1808 zu dem Königreich Westfalen geschlagen. 1813 setzte sich
Preußen wieder in Besitz seines frühern Anteils und erhielt 1815 auch den ehemals sächs. Anteil.
Mansfeld, Kreisstadt im Mansfelder Gebirgskreis des preuß. Reg.-Bez.
Merseburg, am Thalbach und an der Linie Güsten-Sangerhausen der Preuß. Staatsbahnen, Sitz des
Landratsamtes des Mansfelder Gebirgskreises und eines Amtsgerichts (Landgericht Halle a. d. S.), hat
(1895) 2775 (1890: 2745) E., darunter 50 Katholiken, meist Bergarbeiter, das Lutherhaus, das dem
Vater des Reformators ge-
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 561.