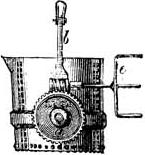1018
Gießhübel – Gifhorn
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gießereiflammofen'
Kupolofen (s. d.) geeigneter ist. Die Abbildung zeigt im Durchschnitt die innere Einrichtung eines neuern, zum
Bronze- oder Eisenschmelzen dienenden G. Die Grundform ist lang gestreckt mit allmählicher Verengung in der Richtung des
Gasstroms. Das zu schmelzende Metall wird durch die Thüröffnung a eingebracht und bei b auf dem Herde ausgebreitet, worauf man
die Thüröffnung vermauert. Nun beginnt die Heizung auf dem links sichtbaren Roste. Die Flamme erhitzt zunächst den Boden des
tiefgelegenen Sumpfes unmittelbar hinter dem Roste und bringt dann allmählich das Metall zum Schmelzen, welches auf der geneigten
Herdsohle hinabfließt, um in dem Sumpfe c sich zu sammeln. Wenn alles geschmolzen und entsprechend stark überhitzt ist, wird das an
der tiefsten Stelle des Sumpfes befindliche, durch einen Thonpfropfen verschlossen gehaltene Stichloch geöffnet, und das Metall fließt
aus. Das Schmelzen pflegt 4–6 Stunden zu dauern; dann wird der Ofen meistens wieder kalt gelegt, und erst nach einigen Tagen oder
Wochen pflegt ein erneutes Schmelzen stattzufinden.
Gießhübl-Puchstein, Kurort in der österr. Bezirkshauptmannschaft und dem Gerichtsbezirk Karlsbad in
Böhmen, 11 km im NO. von Karlsbad, romantisch im Egerthale bei dem Dorfe Rodisfort (588 E.) gelegen, hat Post, Telegraph,
kohlensäurehaltige Natronquellen, eine Wasserheil- und Molkenkuranstalt. G. ist der Ursprungsort des seit mehrern Jahrhunderten
bekannten alkalischen Säuerlings, der unter dem Namen «Mattonis Gieshübler Sauerbrunnen» jährlich in 8 Mill. Flaschen versandt wird.
Das Wasser wird in reinem Zustande gefüllt und dient als Tafelgetränk, wird aber auch gegen katarrhalische Erkrankungen angewendet.
Die klimatische Lage des Ortes macht ihn auch für Luftkuren sehr geeignet, außerdem bildet er einen beliebten Ausflugsort der
Karlsbader Kurgäste. Die Zahl der Kurgäste betrug (1892) 552, der Passanten 23800. – Vgl. Mattoni, Der G. Sauerbrunn (Wien 1877);
Nowak und Kratschmer, Analyse der G. Sauerwässer (Karlsb. 1878); Löschner, Der Kurort G. in Böhmen (12. Aufl., Wien 1883); Gastl,
Der Kurort G. und seine Quellen (in «Europ. Wanderbilder», Zür. 1889).
Gießkanne (Aspergillum), Gattung der
Muscheln; Tier in einer langen, cylinderförmigen Kalkröhre, die vorn von einer durchlöcherten, von einem Kranz kurzer Röhrchen
umgebenen Siebplatte abgeschlossen ist. Hinten verengt sich die Röhre und steht offen. Mit derselben sind die sehr kleinen Schalen
verwachsen. Die Tiere stecken mit der Siebplatte nach unten tief im Sand oder Schlamm des Meeresbodens. Man kennt einige 20 Arten,
welche die wärmern Meere bewohnen.
Gießkannenknorpel, einer der den Kehlkopf (s. d.) bildenden kleineren Knorpel.
Gießpfanne, ein meistens aus Eisenblech gefertigtes, mit einer dünnen Thonschicht ausgekleidetes Gefäß
zur Aufnahme und zum Ausgießen kleinerer oder größerer Mengen geschmolzenen Metalls. Sie wird vornehmlich in Eisen- und
Stahlgießereien täglich benutzt. Die kleinsten G. sind mit ↔ einem eisernen Stiel versehen und pflegen
Gießkellen oder Gießlöffel genannt zu werden.

Textfigur 1:

Textfigur 2:
Größere G. von der in beistehender Fig. 1 ersichtlichen Form werden von mehrern Arbeitern mit Hilfe einer gabelartig auslaufenden
Handhabe (Fig. 2) getragen und werden Gabelpfannen genannt; noch größere werden durch den Kran bewegt. Eine G. der letztern Art,
welche zugleich eine maschinelle Vorrichtung zum Entleeren besitzt, ist in Fig. 3 abgebildet.
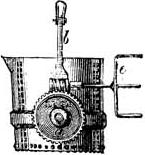
Textfigur 3:
Sie hängt mit zwei Zapfen in dem Bügel b; der eine Zapfen trägt das Getriebe a, in welches eine an dem Bügel gelagerte Schnecke
eingreift. Durch Drehung der Schnecke mittels des Wendekreuzes e erfolgt das Kippen der Pfanne, wobei gleichzeitig jedes
selbstthätige Umkippen, durch welches große Unglücksfälle entstehen könnten, vermieden ist. Bei G. für Stahlguß pflegt man die
Entleerung ohne Kippen mit Hilfe eines am Boden der Pfanne angebrachten Ventils aus feuerfestem Thon zu bewirken.
Giétroz, Glacier de
(spr. glaßieh de schĭetroh), Gletscher im schweiz. Kanton Wallis,
s. Bagne.
Gifford, Swain, nordamerik. Landschaftsmaler, geb. 23. Dez. 1840 zu Naushon (Massachusetts), studierte in
Neuyork unter dem holländ. Maler Albert van Beest, besuchte 1869 Oregon und Kalifornien, 1870 Europa, 1874 Algerien und die Wüste,
1875 Großbritannien und Frankreich. Er ließ sich 1866 in Neuyork nieder, wo er noch wohnt und 1878 Mitglied der Nationalakademie
wurde. Unter seinen Gemälden sind hervorzuheben: Scene in Manchester (1867), Mount Hood in Oregon (1870), Kastell Sant Elmo bei
Neapel, Rückkehr von Philä (1871), Eingang in ein maur. Haus in Tanger, Das Goldene Horn (1873), Reiseboote auf dem Nil (1874),
Oktober an der Küste von Massachusetts, Der Rossettigarten in Kairo (1875), Ägyptische Karawane (1876), Ein Septembertag, Cedern
in Neu-England, Abend in der Sahara, Oase Filiah in Algerien (1877), Dartmouth-Sümpfe, Auf den Lagunen (1878). Großes Aufsehen
erregte sein Verlassener Walfischfänger (Wasserfarben) auf der Ausstellung von 1867 und 1868.
Giffre, Le (spr. schiffr), rechter Nebenfluß der
Arve in der Landschaft Faucigny des franz. Depart. Haute-Savoie, entspringt mit zwei Quellflüssen, die sich unweit Sixt vereinigen,
durchfließt das breite Thal von Samoëns und Taninges und mündet 48 km lang oberhalb Bonneville. Das Val de Sixt bildet den wegen
seiner Wasserfälle berühmten Felsencirkus Fer-à-cheval.
Gifhorn. 1) Kreis im preuß. Reg.-Bez. Lüneburg, hat 802,01 qkm, (1890) 30823 (l5423 männl.,
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1019.