Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Heizung'
aus dem Standrohre heraus und der Druck geht herunter. Eine selbstthätige Feuerregulierung verhindert die Erhöhung des
Druckes über 0,3 Atmosphären.
Die umstehende Fig. 6 giebt eine schematische Darstellung des Körtingschen Systems der Siphonluftregulierung. Der Dampf
wird hierbei den Ofen H durch die Leitung D mit Verteilung von oben (oft aber von unten) zugeführt. Die sämtlichen mit
sauerstofffrei gewordener Luft gefüllten, deshalb nicht rostenden Öfen H aller Etagen erhalten direkt zum Keller führende
Kondensrohre r, welche im Keller an besondere kleine Luftgefäße L angeschlossen werden. Von den Luftgefäßen führen die
Siphonröhren S zur Kellersohle und werden dort von einem gemeinschaftlichen horizontalen Strange aufgenommen, welcher von
unten in das gemeinschaftliche Siphonwassergefäß W ausmündet. Auf diesem Gefäße lastet durch das Luftrohr A der Druck der
äußern Atmosphäre. Das Kondenswasser fließt durch das Überlaufsrohr C in den Kessel zurück. Vor dem Anheizen sind die
Öfen mit sauerstofffreier, weil nicht erneuerter Luft ganz gefüllt, welche nach dem Anheizen und geöffnetem Dampfventil des
Ofens je nach dem Wärmebedarf mehr oder weniger in das Gefäß L gedrängt wird, wobei der mit Dampf gefüllte, von Luft
befreite Teil des Ofens zur Wirkung gelangt. In gleicher Menge und Beschaffenheit wird die eingeschlossene Luft nach Schluß
des Ventils wieder durch den Wasserdruck des Siphongefäßes W in den Ofen H zurückkehren. In der Zeichnung sind alle mit
Wasser gefüllten Röhren und Gefäße durch volle schwarze Linien, der Dampf durch wagerechte Schraffierung, die Luft durch
Punktierung dargestellt. St ist das vorerwähnte Standrohr. Der Kessel K ist in Fig. 7 dargestellt.
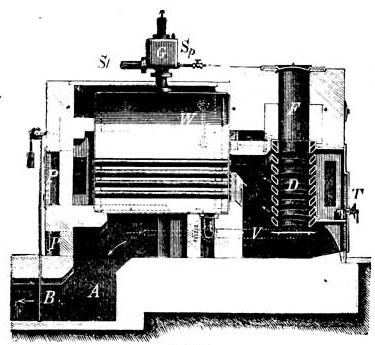
Figur 7:
Unterhalb des Füllschachtes F befinden sich die gußeisernen Wasserröhren D, welche durch ein unteres Verbindungsrohr V und
ein oberes auf der andern Seite des Kessels befindliches Rohr mit dem eigentlichen Kessel kommunizieren. Die
Verbrennungsluft gelangt durch einen Kanal im Mauerwerk von einem Zugregulator her vor den Röhrenrost und kann nur durch
den Brennstoff hindurch zum Kessel gelangen. Die Thür T dient zur Entleerung der Asche, W ist das Wasserstandsglas, A der
Fucks, B der Schieber, P, P Reinigungsdeckel, G Standrohrgefäß, St Standrohr, Sp Speiseventil. Um auch ↔ in
den seltenen Fällen des Überkochens das sämtliche Wasser im Kessel zu behalten, wozu das neue Kesselgesetz die
Möglichkeit giebt, ist im vorliegenden Falle das Standrohr St mit einem Ouecksilbergefäß in Verbindung gebracht, welches
wieder mit dem Zugregulator korrespondiert und bei zu starker Druckentwicklung und Überkochen des Kessels sofort die
Verbrennungsluft vom Kessel abschließt.
Bei der Dampfhochdruckheizung ist das System geschlossen und der Druck demnach
höher. Gewöhnlich geht aber der Kesseldruck von etwa 5 Atmosphären nur bis zur Verteilungsleitung, innerhalb derselben wird
der Druck durch Reduktionsventile (mit dahinter liegenden Sicherheitsventilen) auf 1 Atmosphäre reduziert. Damit der Dampf
nicht in die Rückleitung (Kondenswasserleitung) gelangt, sind selbstthätig wirkende Apparate (Kondenstöpfe) eingeschaltet,
welche zwar dem Kondenswasser, aber nicht dem Dampfe freien Austritt gewähren. Das Kondenswasser fließt in ein Reservoir
im Kesselhaus, wo es durch die Speisepumpe wieder dem Kessel zugeführt und in Dampf verwandelt wird. –
Vorteile der Dampfniederdruckheizung: Ausstellung des Kessels ohne jede Konzession,
rasche Erwärmung, große Ausdehnungsfähigkeit, besonders vorteilhaft für ein ununterbrochenes Heizen.
Nachteile: hohe Temperatur der Heizkörper, Erfordernis bester vorsichtiger Ausführung
und Anwendung selbstthätiger Wärmeregler, hohe Anlagekosten, geringe Wärmereservation; zu diesen Nachteilen kommt bei
der Hochdruckheizung noch die Nichtaufstellung des Kessels unter bewohnten Räumen, also besonderes Kesselhaus, wenn
nicht Wasserröhrenkessel mit 10 mm weiten Röhren verwendet werden, die Bedienung durch einen geprüften Heizer, staatliche
Genehmigung und Aufsicht. Für Geschäftshäuser, Fabriken, deren Bureaus, Hallen u. s. w. ist eine Dampfheizung ganz am
Platze, wenn der Dampf einer Kesselanlage bez. Auspuffdampf einer Dampfmaschine zur Verfügung steht. Ist eine
Kesselanlage nicht vorhanden, so würde die Dampfhochdruckheizung nur für große Gebäude oder ganze Gebäude- ja
Stadtkomplexe (Distriktsheizung der Amerikaner) in Frage kommen, da die Ausdehnungsfähigkeit derselben eine fast
unbegrenzte ist und der Dampf noch zu andern Zwecken Verwendung finden kann, z. B. zum Kochen, Waschen und zum
Maschinenbetrieb.
Um die Vorteile des einen Heizsystems mit denen eines andern zu verbinden, hat man die Heizsysteme wie folgt kombiniert.
D. Die Dampfluftheizung wird als Dampfniederdruck-
und für größere Gebäude als Dampfhochdruckheizung ausgeführt. Es ist eine Luftheizung, bei welcher statt der Kaloriferen
Dampfheizkörper in den einzelnen Heizkammern aufgestellt sind, welche von einer centralen Dampfkesselanlage mit Dampf
versehen werden. Die erwärmte Frischluft kann hierbei, ohne lange horizontale Wege zurückzulegen, fast senkrecht in die zu
heizenden Räume auch bei größern Gebäudeanlagen aufsteigen.
E. Die Dampfwarmwasserheizung, ebenfalls bei
größern Gebäudeanlagen verwendet, in eine Warmwasserheizung, bei welcher das Kesselwasser nicht durch direkte Feuerung,
sondern durch einen Dampfheizkörper (Damfspirale (Anmerkung des Editors: Dampfspirale)) von einer centralen
Dampfkesselanlage aus bedient wird.
F. Die Dampfwasserheizung ist dagegen eine
Dampfheizung, deren Heizkörper (Cylinderöfen) teilweise mit Wasser gefüllt sind, welches direkt oder
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 1014.
