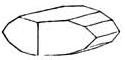606
Mark (Grafschaft) – Markenschutz
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Mark (Münze)'
1885 auch) zu 20 Pf. (⅕ M.), sämtlich 900 Tausendteile fein, so daß 90 M. in Silbermünzen 1 Pfd. oder 180 M. 1 kg
wiegen. Silbermünzen im Betrage von mehr als 20 M. in Zahlung zu nehmen, sind nur Reichs- und Landeskassen
verpflichtet. (Über die deutschen Goldmünzen s. Krone, über die
Nickelmünzen s. Nickel und über die Kupfermünzen s. Pfennig; vgl. auch
Münze und Münzwesen.)
M.(finländ. Markka) heißt auch die seit 1863 eingeführte Geldeinheit Finlands. Die finländische M. wird in 100 Pf.
(Penniä, Einzahl: Penni) geteilt. Die finländ. Markwährung war ursprünglich eine Silberwährung, die M. = ¼ russ. Silberrubel
und bis auf ein Unbedeutendes dem franz. Franken Silbercourant (d. i. einem Fünftel des silbernen 5-Frankenstücks)
gleich, da sie kaum 1/1000 g weniger Feinsilber enthielt. Infolge des Gesetzes vom 9. Aug. 1877 trat 1. Juli 1878 die
Goldwährung in Kraft und wurden sämtliche Silbermünzen Scheidemünzen. Die finländ. Goldmark ist genau einem franz.
Goldfranken und seit Aug. 1886 auch ¼ Goldrubel (s. Imperial) gleich.
(S. Frank.) Es werden Goldstücke zu 10 und zu 20 M. geprägt, 900 Tausendteile fein, also nur im
Äußern von den franz. 10- und 20-Frankenstücken verschieden. – Nach M. von 16 Schill. zu 12 Pf. wurde bis zur
Einführung der Reichsmarkrechnung in Hamburg, Schleswig-Holstein und Lübeck gerechnet.
(S. Banco.) In Dänemark war bis 1875 die M. der sechste Teil des
Rigsdalers (s. d.), 16 M. dänisch Courant = 5 M. schleswig-holstein. Courant.
In Schweden war der Daler (s. d.) bis 1776 in 4 M. eingeteilt, in Norwegen hatte bis 1873 der
Speciesthaler (s. d.) 5 M. oder Ort.
Mark, eine Grafschaft (2200 qm) im ehemaligen Westfälischen Kreise,
welche im N. an das Fürstentum Münster, im O. an das Herzogtum Westfalen und im S. und W. an das Herzogtum Berg
grenzte, umfaßt jetzt die Kreise Hamm, Soest, Dortmund, Iserlohn, Bochum, Altena und Hagen des preuß. Reg.-Bez.
Arnsberg. Das Land wird durch die Ruhr in den Hellweg, den größern, nördlichen,
und in das Sauerland, den kleinern, südl. Teil geteilt. Die Grafschaft war in frühester
Zeit ein Teil von Westfalen, gehörte seit dem Ende des 12. Jahrh. den Grafen von M., kam im 14. Jahrh. an die Grafen von
Cleve und nach dem Jülich-Cleveschen Erbfolgestreit (s. Jülich) durch den Vergleich von Xanten
1614 vorläufig, durch den Erbvertrag mit Pfalz-Neuburg 1666 endgültig an das Haus Brandenburg. Im Tilsiter Frieden
1807 wurde sie an Napoleon abgetreten, von diesem 1808 zum Großherzogtum Berg geschlagen und machte den
beträchtlichsten Teil des Ruhrdepartements aus, bis sie 1813 von Preußen wieder in Besitz genommen wurde. Das
Haus M., das alte Schloß der Grafen von der M., liegt im Dorfe M. bei Hamm. – Vgl.
Natorp, Die Grafschaft M. (Iserlohn 1859).
Markánt (frz. marquant),
sich hervorhebend, hervorstechend.
Markasīt, Graueisenkies,
Vitriolerz, das rhombische Eisenbisulfid,
FeS2 (dessen reguläre Modifikation der Eisenkies ist). Die
graulich-speisgelben Krystalle sind tafelartig (s. nachstehende Fig. 1, Kombination von Geradendfläche, Prisma und
2 Brachydomen),
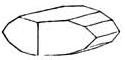
Figur 1:
schmal säulenförmig oder pyramidal, nach dem Grundprisma vielfach verzwillingt zu speerspitzenförmigen Gestalten
↔ (Speerkies, Fig. 2)

Figur 2:
oder zu kammähnlichen Gruppen (Kammkies); auch finden sich in Mergeln und
Thonen Knollen von radial faseriger und stengliger Struktur (Strahlkies), oder
Massen von dichter Zusammensetzung (Leberkies). Die weniger festen
Vorkommnisse nennt man auch Wasserkies oder
Weicheisenkies. Der Verwitterung zu Eisenvitriol ist der M. noch stärker unterworfen
als der Eisenkies.
Mark Banco (abgekürzt M/Bco),
s. Banco.
Marke (Waren-,
Fabrik-, Handelszeichen), das Zeichen,
welches ein Gewerbtreibender (Kaufmann, Fabrikant u. s. w.) an seinen Waren oder deren Verpackung zur Unterscheidung
von den Waren seiner Konkurrenten anbringt. Diese M. genießen in den einzelnen Ländern, falls sie in die sog.
Zeichenrolle eingetragen sind, gesetzlichen Schutz
(s. Markenschutz).
Marke, beim Pferde, s. Kunde.
Marken (ital. Marche), Landschaft
(Compartimento) in Italien, umfaßt folgende Provinzen:
| | | |
| Flächenraum in qkm | | |
| | Einwohner | Auf |
| | | | 1 qkm |
| Provincen | | nach | | |
| offiziell | Strelbitzkij | 1881 | |
| | | | |
| | | | |
| Ancona | 1907 | 2041 | 267338 | 140 |
| Ascoli-Piceno | 2096 | 1995 | 209185 | 100 |
| Macerata | 2737 | 2777 | 239713 | 87 |
| Pesaro-Urbino | 2964 | 3023 | 223043 | 75 |
| | | | | |
| | | | | |
| Marken | 9704 | 9386 | 939279 | 97 |
Die neue Ausmessung der Generaldirektion der Statistik ergab einen Flächenraum von 9748 qkm, eine Berechnung vom
31. Dez. 1892: 966408 E., d. i. 99 E. auf 1 qkm.
Markenschutz, der gesetzliche Schutz von Marken (Waren-, Fabrik-, Handelszeichen,
s. Marke). Nachdem solche Warenzeichen längst im Verkehr eingeführt waren, hat die neuere
Gesetzgebung der einzelnen Staaten die auf Anmeldung (oder Hinterlegung) bei der zuständigen Behörde (in Deutschland
bei dem Handelsgerichte, vom 1. Okt. 1894 ab bei dem Patentamt in Berlin) in ein Register eingetragenen und
veröffentlichten Warenzeichen in dem Sinne unter gesetzlichen Schutz gestellt, daß der Eingetragene ein ausschließliches
Recht auf das Warenzeichen hat. Das Recht ist vererblich und mit dem Geschäft des Eingetragenen veräußerlich.
Das deutsche Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen, welches 1. Okt. 1894 an Stelle des Markenschutzgesetzes
vorn. 30. Nov. 1874 in Kraft trat, enthält folgende Bestimmungen: Wer wissentlich oder aus grober Fahrlässigkeit Waren
oder deren Verpackung oder Umhüllung oder Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefe, Empfehlungen, Rechnungen
oder dergleichen mit dem Namen oder der Firma eines andern oder mit einem gesetzlich geschützten Warenzeichen
widerrechtlich versieht oder dergleichen widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, ist dem
Verletzten zur Entschädigung verpflichtet. Hat er die Handlung
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 607.