Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Bogdanowitsch (Modest Iwanowitsch)'
2 Bde., Petersb. 1863–69), «Geschichte des Krieges von 1814» (deutsch, 2 Bde., Lpz. 1866),
«Geschichte der Regierung Alexanders I.» (6 Bde., Petersb. 1869–71), «Der orient. Krieg 1853–56»
(4 Bde., ebd. 1876). B. verfaßte außerdem eine Militärencyklopädie (6 Bde., 1852–58).
Bogdo, Großer und
Kleiner, zwei Berge im russ. Gouvernement Astrachan am
linken Ufer der Wolga, alleinstehende Triasgruppe, in sandig-thoniger Steppe, östlich von
Tschernyj-jar. Der Große B. ist 176 m, der Kleine 28 m hoch. Im NO. vom Großen B. liegt der
Salzsee Baskuntschak (s. d.).
Bogdo-ola («Heiliger Berg»), ein 3–4000 m hoher,dreispitziger Gipfel
im östl. Teile des Thianschan in Centralasien. Die ganze den Namen B. tragende Massenerhebung
zieht von W. nach O. unweit Urumtschi, in 43 1/2° nördl. Br. und 88–89° östl. L. von Greenwich.
Bogen, in der
Baukunst ein aus keilförmigen Steinen zusammengesetztes
gebogenes Stück Mauerwerk, das auf zwei Stützen ruht, den Raum zwischen diesen überdeckt und
gewöhnlich noch zum Tragen darüber befindlicher Bauteile bestimmt ist.
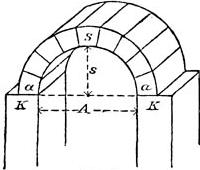
Figur 1:
Für einen B. (Fig. 1) sind folgende Bezeichnungen üblich: die Mauerteile, auf denen der B.
aufsitzt, heißen Kämpfer oder
Widerlager (K); die untersten Steine des B. werden die
Anfänger oder Füße (a)
genannt. Der oberste Stein, welcher im Scheitel des B. sitzt,
heißt Schlußstein (S). Die in der Mauerflucht sichtbare
vordere Fläche des B. heißt Stirn,
Haupt oder Schild; seine
äußere krumme Fläche wird Rücken oder
äußere Leibung, seine innere krumme Fläche
innere Leibung benannt. Den Abstand (A) zwischen den
Widerlagern bezeichnet man mit Spannweite, die Höhe (s) des
Scheitels über den Kämpferfugen mit ↔ Stich
oder Pfeilhöhe. Die Stirnseite wird oft durch ein der
Bogenlinie folgendes Profil ausgezeichnet (s. Archivolte). Der Schlußstein ist
meist größer als die andern Wölbsteine, oft auch besonders hervortretend und mit Blattornamenten,
Masken u. dgl. verziert. Auch die Kämpfer (s. d.) zeigen häufig
architektonisch durchgebildete Formen. Bisweilen wird der B. rein dekorativ als
Blende (s. d.) verwendet. B. kommen oft in langen Reihen nebeneinander vor
und heißen dann Bogenreihen (Arkaden, s. d.).
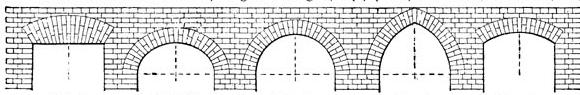
Figur 2 bis 6:
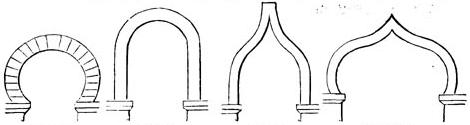
Figur 7 bis 10:
Der B. bildet entweder einen Halbkreis (Rundbogen,
s. Fig. 4), oder einen Teil eines solchen (Stichbogen,
Flachbogen, Fig. 6), oder eine halbe Ellipse
(Korbbogen, Fig. 3), oder besteht aus zwei, in einem Winkel
zusammenstoßenden B. (Spitzbogen, Fig. 5), oder er zeigt die
Form etwa eines Dreiviertelkreises (Hufeisenbogen, Fig. 7).
Tudorbogen ist ein gedrückter Spitzbogen. Wird der Bogen über
die Stützpunkte nach unten verlängert, so nennt man ihn
gestelzt (Fig. 8); ist diese Verlängerung eine einseitige,
so heißt er steigender B. Wird die Spitze eine Spitzbogens
nach oben schlank ausgezogen, so nennt man den B. Eselsbogen
(Fig. 9); diesem ähnlich, nur gedrückter ist der persische B.
oder Kielbogen (Fig. 10).
Scheitrechte B. (Fig. 2) nennt man jene, deren Unterkanten
eine wagerechte Linie bilden.
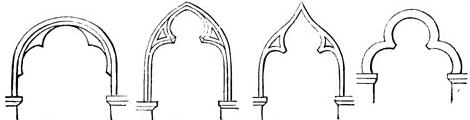
Figur 11 bis 14:
Durch Besetzung der Innenlinie eines B. mit Vorsprüngen (Nasen)
lassen sich mannigfache verzierte Formen bilden (Fig. 11–14), sodaß sich im ganzen über 50
verschieden benannte B. ergeben. – Der B. ist einer der wichtigsten konstruktiven und
künstlerischen Formen der Baukunst. Die Ägypter und Griechen kannten ihn, bildeten aber noch
vielfach seine Gestalt durch Auskragungen wagerechter Steinschichten, während doch das
konzentrische Aufbauen der Keilstücke für den B. charakteristisch ist. Die Etrusker waren die
ersten, die den Bogenbau systematisch durchführten. Zu hoher Vollendung und Durchbildung nach
technischer und künstlerischer Seite gelangte er bei den Römern, deren ganzes Bauwesen durch den
B. beherrscht wurde. Sie verwendeten ausschließlich den Rundbogen, der dann bis ins 12. Jahrh.
die Herrschaft sich erhielt. Nur die Mohammedaner zogen den Hufeisenbogen vor. Die Gotik führte
den Spitzbogen ein, der bei ungleichen Spannweiten doch zu gleicher Scheitelhöhe (durch
schlankere Bildung) hinaufgeführt werden kann und somit eine freiere Behandlung der
Grundrißgestaltung ermöglicht. Die Renaissance nahm den Rundbogen wieder an, verwendete ihn aber
weniger streng als die Römer und das frühere Mittelalter. Die künstlerisch weniger
ausdrucksvolle Form des Stichbogens erscheint erst seit dem 18. Jahrh. öfter in der Architektur.
In der Spätgotik und im Barockstil suchte man verschiedene neue Bogenformen einzuführen, die aber
meist willkürlich gewählt sind und der Konstruktion zuwiderlaufen, daher auch bald wieder
verworfen wurden.
Bogen,
elektrischer, glänzende Lichterscheinung, welche, dem
Funkenstrom bei der statischen
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 207.
