Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gleichgewicht'
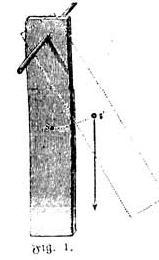
Textfigur: Fig. 1
Im stabilen G. eines schweren Körpers hat dieser eine solche Lage,
das sein Schwerpunkt s vertikal unter dem Drehungspunkt (Aufhängepunkt), also so tief als möglich liegt
(s. beistehende Fig. 1),
daß daher, wenn der Körper durch eine kleine Drehung aus dieser Lage herausgebracht wird, sein
Schwerpunkt höher als früher zu liegen kommt (bei s'); infolgedessen wird der Körper immer wieder
seine erste Lage einzunehmen suchen; hierher gehören alle aufgehängten und mindestens in einem Dreieck
unterstützten Körper und alle Körper, die in einer waagerechten Achse (Wage) oder in zwei zueinander
unter rechtem Winkel gerichteten, wagerechten Achsen, mit darunter liegendem Schwerpunkte, hängen,
wie z.B. bei der Cardanischen Aufhängung für Schiffslampen, Schiffskompasse, Schiffsbarometer u. s. w.
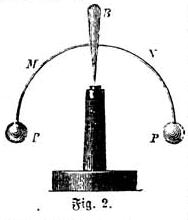
Textfigur: Fig. 2
Manchmal scheint ein Körper unterstützt zu sein und ist dennoch, weil sein Stützpunkt höher als der
Schwerpunkt liegt, aufgehängt; dies ist z. B. der Fall bei einem auf seiner Spitze ruhenden Kegel B
(Fig. 2 ), bei
dem mittels eines Drahtbogens M N zwei gleiche Bleikugeln P und P symmetrisch zu beiden Seiten des
Kegels derart befestigt sind, daß der gemeinschaftliche Schwerpunkt der ganzen Körperverbindung
unter den Stützpunkt zu liegen kommt. Infolgedessen ist der Kegel eigentlich aufgehängt, mithin
im stabilen G. In ähnlicher Weise verhält es sich mit vielen Balancierfiguren, z. B. mit den
bekannten galoppierenden Pferden, Sägemännern u. dgl. m., die an der Tischkante aufgehängt sind.
Bei den unterstützten Körpern ist die Stabilität (s. d.) von verschiedenen Umständen abhängig.
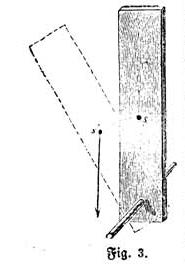
Textfigur: Fig. 3
Im labilen G. hat der Körper eine solche Lage,
daß der Schwerpunkt s vertikal über dem
Drehungspunkte (Stützpunkt), also möglichst hoch liegt (s. Fig.3), daß daher, wenn
der Körper durch eine kleine Drehung aus dieser Lage herausgebracht wird, sein Schwerpunkt stets
tiefer als früher zu liegen kommt (bei s'), weshalb derselbe nicht mehr zurückkehrt, sondern,
die störende Bewegung fortsetzend, eine noch tiefere Lage aufsucht; hier z. B. kommt das Brett
nach seiner Umdrehung in die stabile Lage wie bei Fig. 1.
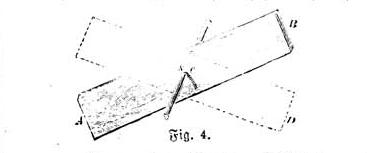
Textfigur: Fig. 4
Im indifferenten G. befindet sich ein Körper, wenn der Drehungs-
und Stützpunkt durch seinen Schwerpunkt geht (s. Fig. 4), so daß der Schwerpunkt s durch eine
Drehung des Körpers weder gehoben noch gesenkt wird; hierher gehört z. B. das ↔
Brett in Fig. 4, das im G. bleibt, es mag die Lage AB oder CD oder irgend eine beliebige Lage
durch Drehung um die Achse annehmen; ferner sind hier zu nennen Wagenräder, Kugeln und
Cylinder auf wagerechtem Boden u. s. w.
über das G. schwimmender Körper s. Schwimmen. über das G. der flüssigen Körper s. Hydrostatik, der gasförmigen
s. Aerostatik. - über das G. der Staaten s. Politisches Gleichgewicht.
Gleichheit ist das Verhältnis, vermöge dessen von zweierlei irgend
einer Art dasselbe gilt. So spricht man von G. der Dinge, wenn sie dieselben Eigenschaften
haben; von G. der Begriffe, wenn sie durch dieselben Merkmale gedacht werden
(s. Identität); von G. zweier Flächen, wenn sie dieselbe Größe haben u.s. w.
Gesellschaftliche G. nennt man dasjenige Verhältnis
der zu einer Gesellschaft gehörigen Personen, vermöge dessen sie gleiche Rechte und Pflichten
haben. Schon das ältere Naturrecht stützte sich auf den Begriff der G., indem es denselben zur
Bestimmung der ersten Grundbegriffe des Rechts benutzte. Aber erst zur Zeit der Französischen
Revolution ward die G. aller förmlich proklamiert. Allgemein anerkannt ist die Forderung
der G. vor dem Gesetz. Jeder Staatsbürger soll den Schutz der Gesetze gleichmäßig genießen
und diesen gleichmäßig Unterthan sein.
Gleichnis, ein Ausdruck oder eine Wendung, durch die bestimmte
Eigenschaften eines Gegenstandes dadurch hervorgehoben werden, daß ein anderer,
sonst durchaus verschiedener Gegenstand, der aber diese Eigenschaften ebenfalls aufweist,
bei der Schilderung erwähnt wird. Das übereinstimmende heißt
Vergleichungspunkt
(tertium comparationis, d. i. das Dritte des Vergleichs).
Ein weiter ausgesponnenes, zur Erzählung entwickeltes G. heißt Parabel (s. d.).
Die sog. biblischen G. sind ausgeführte Parabeln,
die religiöse Ansichten durch Erzählungen aus Natur- und Menschenleben gemäß
der morgenländ. Vorliebe für bildliche Darstellung veranschaulichen.
Gleichschritt, die gleichmäßige Bewegung einer Truppenabteilung,
in der der einzelne Schritt von sämtlichen Mannschaften mit demselben Fuße, in gleicher
Länge und mit taktmäßigem Niedersetzen der Füße ausgeführt wird. Der G. gestattet ein
dichtes Anschließen der hintereinander marschierenden Mannschaften und giebt der
marschierenden Truppe Halt und feste Ordnuug. Er wird daher nicht nur auf dem
Exerzierplatz und zu Paradezwecken, sondern auch auf dem Gefechtsfelde dann
angewendet, wenn es darauf ankommt, bei überwältigenden Eindrücken des
Kampfes eine geschlossene Truppe in ruhiger und geordneter Bewegung zu erhalten.
In allen übrigen Fällen vermeidet man den G., da er auf die Dauer große Anstrengung
erfordert. Schon die Römer und Griechen wendeten den G. an; im Mittelalter geriet
er in Vergessenheit und erst seit der Mitte des 18. Jahrh. kam er wieder in Gebrauch.
