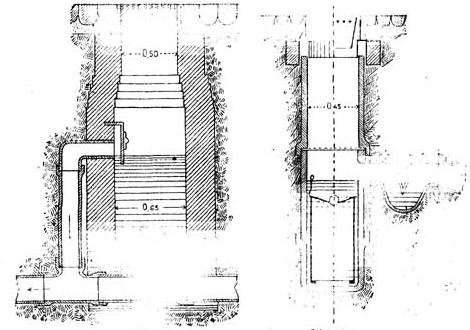552
Gullivers Reisen – Gümbel
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Gülle'
als das Körnerwachstum gefördert. In einigen Gegenden nennt man G. auch die über den Stalldung geleitete Jauche, welche
dabei einen Teil der löslichen Substanzen desselben aufgenommen hat. Die Zusammensetzung der G. ist je nach dem Futter,
der Tierart u. s. w. eine sehr wechselnde; im Mittel enthält die unverdünnte G. auf 1000 Teile: 982 Wasser, 18 feste Stoffe; in
letztern 7 organische Substanz, 1,5 Stickstoff, 0,9
Phosphorsäure, 5 Kali, 1 Natron, 0,5 Kalk u. s. w. – Vgl. Hartstein, Die flüssige Düngung
(Bonn 1859); E. Wolfs, Praktische Düngerlehre (11. Aufl., Verl. 1889).
Gullivers Reisen (spr.göll-,
Gulliver’s travels), berühmter Roman von Swift (s. d.).
Gully (engl., spr. göllĭ, «Einlauf»), die bei Anlage der Schwemmkanalisation
notwendigen Bauwerke, um bei Einführung des Haus- und Regenwassers in die Kanäle das Hineingelangen von Sinkstoffen
(Sand, Schlamm u. dgl.) möglichst zu vermeiden. Da die Zahl derartiger in einem Netz von Entwässerungskanälen anzulegender
Einläufe eine sehr große ist und dadurch die Ausgabe dafür sehr hoch wird, muß große Sorgfalt darauf verwendet werden, deren
Konstruktion so einfach wie möglich zu machen. Man hat zu berücksichtigen, ob viel oder wenig Schlamm zur Abführung kommt,
um danach die Abmessungen zu treffen, ob kälteres Regen- oder wärmeres Hauswasser einfließt, um event. die Sicherung
gegen Einfrieren zu treffen. Ein Wasserverschluß (s. d.) ist stets anzuwenden.
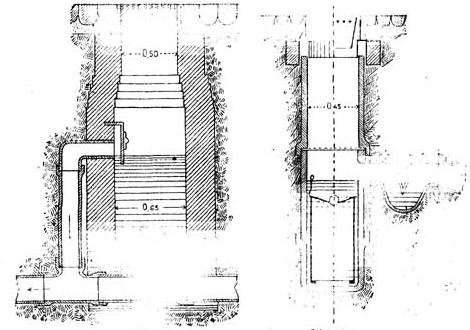
Figur 1 und 2:
Die vorstehenden Abbildungen zeigen die Typen von Berlin (Fig. 1) und Frankfurt a. M. (Fig. 2). Ersterer G. ist aus Stein, letzterer
aus gebranntem Thon hergestellt. Der sich in ersterm sammelnde Schlamm wird durch kleine Bagger herausgeholt, während bei
dem letztern sich der Schlamm in einem Eimer niederschlägt.
Gülte, Bezeichnung für Rente bei dem Rentenkauf (s. d.).
Gültigkeit der Erkenntnis, objektive und subjektive G.,
s. Objekt und Subjekt.
Gulussa, der zweite Sohn des numidischen Königs Massinissa, wurde von seinem Vater aus Anlaß
von dessen Zwistigkeiten mit Karthago wiederholt nach Rom geschickt, um die von den karthag. Gesandten gegen Massinissa
erhobenen Anklagen zu entkräften. In Karthago, wo er 152 v. Chr. die Wiederaufnahme der verbannten Freunde des
↔ Massinissa verlangen sollte, ward er nicht eingelassen. Aus Rache überfiel er in dem bald hernach
ausgebrochenen Kriege das besiegte und ohne Waffen entlassene Heer der Karthager treulos und machte den größten Teil
desselben nieder. Nach Massinissas Tode 149 v. Chr. erhielt er durch Scipio, welcher die Verteilung des Reichs unter dessen
drei Söhne überkommen hatte, den militär. Teil der königl. Gewalt und leistete hierauf den Römern als Reiterführer gute Dienste
gegen die Karthager. Er starb kurze Zeit vor seinem ältesten Bruder Micipsa (gest. 118 v. Chr.), nachdem er 120 v. Chr. neben
seinen beiden Söhnen den illegitimen Sohn seines jüngsten Bruders, Jugurtha (s. d.), als Sohn und
Miterben angenommen hatte.
Gulwa, Strom in Australien, s. Murray.
Gulyas (Gulasch), abgekürzt für
Gulyás-hús (Rinderhirtenfleisch), ungar. Nationalgericht, angeblich so hergestellt, wie die
ungar. Rinderhirten in der Puszta ihr Fleisch zubereiten. Das G. besteht aus zollgroßen Rindfleischstücken, die samt ihrem
natürlichen Fett mit Zwiebeln, Salz, Kümmel und Paprika weichgedünstet werden.
Gum (frz. goum), Abteilungen irregulärer alger. Reiterei, die aus
Eingeborenen des Landes zusammengesetzt ist, im Gegensatz zu den regulären Spahisregimentern. Diese Truppen stehen
unter dem Befehl arab. Chefs, die von der franz. Regierung eingesetzt sind; sie versehen im Frieden den Sicherheitsdienst in
den Grenzdistrikten, im Kriege Vorpostendienst u. dgl. Das Bindeglied zwischen ihnen und der regulären Armee bildet die durch
Dekret vom 10. Dez. 1830 errichtete reguläre eingeborene Reiterei oder die
Chasseurs algériens, die später Spahis
genannt wurden.
Gumal oder Gomul, Fluß und Paß in Afghanistan in der
Landschaft Wasiristan, führt von der westl. Sulemankette über die östliche nach Dera-Ismail Chan am Indus.
Gümbel, Karl Wilh. von, Geolog, geb. 11. Febr. 1823 zu Dannenfels in der Rheinpfalz, widmete sich
in München und Heidelberg dem Studium des Bergfachs und trat 1848 auf dem Steinkohlenwerke zu St. Ingbert in der Pfalz in
den praktischen Montandienst. 1851 zur Leitung der geognost. Landesaufnahme nach München berufen, rückte G. 1879 zum
Vorstand der obersten Bergbehörde in Bayern auf. Auch wirkte G. als Honorarprofessor an der Münchener Universität und als
Lehrer an der Technischen Hochschule. 1882 wurde er durch Verleihung des Verdienstordens der Bayrischen Krone in den ^
Adelstand erhoben. Er ist Ehrenbürger der Stadt München. Nach ihm als Entdecker wurde von von Kobell ein im Thonschiefer
von Nordhalben vorkommendes faseriges, im wesentlichen aus einem wasserhaltigen Thonerdesilikat bestehendes Mineral
Gümbelit genannt, und eine unter den Versteinerungen vorkommende, zu den
Daktyloporen gehörige Koralline trägt von G. den Namen Guembelina. Von der unter seiner
Leitung stehenden «Geognost. Beschreibung des Königreichs Bayern» sind bis jetzt vier umfangreiche Bände, enthaltend das
bayr. Alpengebirge und sein Vorland, das ostbayr. Grenzgebirge, das Fichtelgebirge mit dem Frankenlande und der Frankenjura
(Gotha und Cass. 1861–91),
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 553.