457
Notauslässe – Noten
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Notar'
Gesetz über das Notariatswesen (Stuttg. 1887); Weißler, Das preuß. Notariat (Berl. 1888); Sydow und
Hellweg, Preuß. Gesetze betreffend das Notariat (3. Aufl., ebd. 1895); Artikel Notariat im
«Handwörterbuch der Staatswissenschaften«, Bd. 5 (Jena 1893) und im «Österreichischen
Staatswörterbuch», Bd. 2 (1896); Artikel Nichtstreitige Gerichtsbarkeit in von Stengels «Wörterbuch
des deutschen Verwaltungsrechts», 2. Ergänzungsband (Freib. und Lpz. 1893); Rudorff, Freiwillige
Gerichtsbarkeit und Notariat in Bayern und Baden (Berl. 1895).
Notauslässe, Anlagen bei der Kanalisation größerer Städte, welche
bezwecken, daß bei außerordentlichen Regenfällen ein Teil des Kanalwassers in den nächsten
natürlichen Wasserrecipienten abgeführt wird, bevor es zu den Pumpen gelangt. Die N. bestehen aus
Überfallschwellen, die an geeigneten Stellen der Kanäle in bestimmter, von den örtlichen
Verhältnissen abhängiger Höhe angebracht sind. Die Überfallschwellen müssen möglichst breit angelegt
werden, um viel Wasser bei der meist beschränkten Höhe der N. abführen zu können; in den Fällen, wo
die Höhe der Schwelle Schritt halten muß mit der Höhe des Wasserstandes des Recipienten, so
eingerichtet sein, daß bewegliche, hölzerne oder eiserne Dammbalken dies ermöglichen. Diese Anlagen
müssen zugänglich sein, besonders in letzterm Falle.
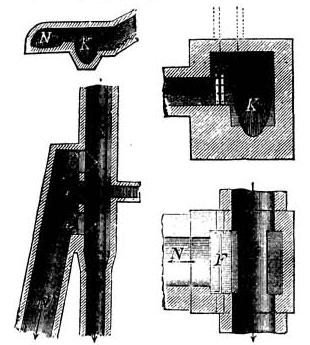
Figur 1 und 2:
Vorstehende Fig. 1 zeigt eine Anlage mit fester Überfallschwelle und drei Öffnungen a, Fig. 2 eine Anlage mit Erhöhung der Überfallschwelle durch eiserne
Balken, welche in den angebrachten eisernen Führungen F zu
bewegen sind. In beiden Figuren ist der Kanal mit K, der
Notauslaß mit N bezeichnet. Auf Tafel: Kanalisation, Fig. 22, 23, sind N. in Kreuzung mit einem Gasrohr
dargestellt.
Notbedarf. Nach Gemeinem Recht genießen gewisse Schuldner die
Rechtswohlthat des N. (beneficium competentiae), d. h. der
Gläubiger muß dem Schuldner lassen, was dieser zur Notdurft des Lebens gebraucht. Solches Recht
haben z. B. die Ehegatten gegeneinander, Ascendenten gegen Forderungen der Descendenten, der
Schenkgeber gegen den Beschenkten, der Gemeinschuldner, welcher sein Vermögen abgetreten hat, wegen
des Neuerworbenen gegen seine bisherigen Gläubiger, nach der Praxis des Gemeinen Rechts und einigen
Partikularrechten der Besitzer eines Lehns wegen einer Kompetenz aus
↔
den Lehnsfrüchten, der Fideïkommißbesitzer wegen der Früchte des Fideïkommisses. Das Preuß. Allg.
Landrecht hat die Kompetenz des Schenkgebers dahin erweitert, daß ihm der Beschenkte bis zu 6 Proz.
von dem Werte der geschenkten Sachen jährlich zu leisten hat (Ⅰ,11, §§. 1123 fg.). Die übrigen
neuern Gesetze haben die Rechtswohlthat nicht aufgenommen; sie ist aber durch die Deutsche
Civilprozeßordnung, welche andere Beschränkungen der Zwangsvollstreckung (s. d.)
eingeführt hat, nicht beseitigt. Dagegen hat die Deutsche Konkursordnung die Rechtswohlthat des
Gemeinschuldners bezüglich der seit 1. Okt. 1879 eröffneten Konkurse aufgehoben.
Notbede, die in außerordentlichen Fällen geforderte und erhobene
Bede (s. d.).
Noteč
(spr. -tetzsch), poln. Name der
Netze
(s. d.).
Noteid, im frühern Civilprozesse der vom Richter auferlegte Eid, im
Gegensatz zu dem zugeschobenen, also auf dem Parteiwillen beruhenden. (S. Eid.)
Noten
(lat.), Zeichen, in der Musik die Zeichen der Tonschrift.
Man bediente sich ihrer schon im Altertum. Die Hebräer hatten Accente oder dynamische Angaben
als Tonzeichen, die Griechen Buchstaben in zwei Formen, nämlich umgelegte Buchstaben für
Instrumental- und aufrecht stehende für Vokalmusik. Aus beiden Elementen, den hebräischen und
griechischen, erwuchs unser Notensystem. Die Accente ergaben nach und nach unsere N., die
Buchstaben lieferten die Namen. Die in Rom gebräuchlichen Accente, Neumen (s.
Neuma) genannt, wurden erst, gleich den morgenländ. Accenten, frei über die zu
singenden Worte geschrieben, später mit Linien durchzogen, die die Tonhöhe genauer bestimmten;
vor die Linie schrieb man den Buchstaben als Name des betreffenden Tons und hieraus entstanden
die verschiedenen Notenschlüssel (s. d.). Zur selben Zeit, im 11. Jahrh.,
führte
Guido
(s. d.) von Arezzo die wahrscheinlich schon früher bekannte
Solmisation
(s. d.) allgemein beim Gesangunterricht ein, wodurch die Töne nach den sechs Silben
ut re mi fa sol la
eine Benennung erhielten, die die Buchstabennamen beseitigte und die noch jetzt in Italien,
Frankreich und England gebräuchlich ist. Das letzte, was sich in der Notenschrift ausbildete,
war die Angabe der Zeitdauer der Töne, die sog. Mensur oder Tonmessung. Diese hing zusammen mit
der Entstehung der Harmonie oder Mehrstimmigkeit, die deshalb anfangs auch Mensuralmusik hieß.
Vom 10. bis 15. Jahrh. wurde an der Ausbildung der musikalischen Mensur gearbeitet. Zur Zeit der
Erfindung der Buchdruckerkunst war die Notenschrift nahezu vollendet, in der Folge ist sie nur
nach einzelnen Seiten hin reicher und freier ausgebildet. Diese Notenschrift, gegründet auf
anschauliche dynamische Zeichen, nicht auf Buchstaben, nimmt die Mitte ein zwischen
Buchstabenschrift und Bild und ist ein Gebäude von solcher Festigkeit, daß keiner der vielen
spätern Versuche, eine andere Aufzeichnung der Musik zur Geltung zu bringen, sie hat verdrängen
können. (S. Musiknotendruck.) – Vgl. Riemann, Studien zur Geschichte der
Notenschrift (Lpz. 1878).
Im diplomatischen Verkehr sind N. die von einer Regierung
der andern gemachten formellen Mitteilungen oder Eröffnungen. Solche N. können entweder direkt
an die betreffende Regierung gerichtet
Anmerkung: Fortgesetzt auf Seite 458.
