70
Pfortader – Pfreimd
Anmerkung: Fortsetzung des Artikels 'Pforta'
Die Grundlage des Unterrichts war und blieb die altklassische Philologie. Wichtige Verbesserungen des innern Zustandes
der Anstalt begannen unter dem Rektor Geisler (1779– 87), die unter des Oberhofpredigers Reinhard Einfluß von den
Rektoren Barth (1787–95) und Ilgen (1802–31) fortgesetzt wurden. Durchgreifende und umfassende Veränderungen
erfuhr die Schule dadurch, daß sie 1815 an Preußen kam. Klopstock, Fichte, Leopold von Ranke sind in P. vorgebildet
worden. – Vgl. Puttrich, Schulpforta, seine Kirche und sonstigen Altertümer (Lpz. 1838); Wolff, Chronik des Klosters P.
(2 Bde., ebd. 1843–46); Kirchner, Die Landesschule P. in ihrer geschichtlichen Entwicklung seit Anfang des 19. Jahrh.
(Naumb. 1843); Bittcher, Pförtner-Album (Lpz. 1843); Corssen, Altertümer und Kunstdenkmale des Cistercienserklosters
St. Marien und der Landesschule zur Pforte (Halle 1868); Böhme, Zur Geschichte des Cistercienserklosters St. Marien zur
Pforte (Naumb. 1873); F. Ranke, Rückerinnerungen an Schulpforta (Halle 1874); Böhme, Nachrichten über die Bibliothek
der königl. Landesschule P. (Naumb. 1880 u. 1883); Hoffmann, P. in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung während des
12. und 13. Jahrh. (Halle 1888); ders., Pförtner-Stammbuch (Berl. 1893); Roßner, Der Name des Klosters P. (Halle 1893);
Böhme, Urkundenbuch des Klosters P. (1. Halbbd., ebd. 1893).
Pfortader (Vena portae oder
portarum, s. Tafel: Die Blutgefäße des Menschen,
Fig. II, 41, und Tafel: Die Baucheingeweide des Menschen I, 25), die große Ader,
die das vom Magen, den Gedärmen, der Bauchspeicheldrüse und der Milz kommende dunkelrote (venöse) Blut sammelt
und sich, nachdem sie einen gegen 7cm langen Stamm gebildet, in die Leber ergießt, in der sie sich wieder zu feinen
kapillaren Zweigen auflöst. (S. Leber und Kreislauf des Blutes.) Das
Pfortaderblut nimmt somit einen Teil der Verdauungsprodukte sowie Stoffwechselprodukte aus der Milz auf und liefert das
Material zur Gallenbereitung; es gelangt sodann mittels der Lebervenen in die untere Hohlader und durch diese in das Herz.
Bei Störungen im allgemeinen Kreislauf (durch Lungenkrankheiten, Herzfehler) sowie Behinderung der Blutcirkulation in der
Leber (Säuferleber) kann es zu Stauungen des Blutes in der P. kommen, die sich als Magen- und Darmkatarrhe,
Hämorrhoiden geltend machen und nicht selten zum Austritt des Blutserums in die Bauchhöhle (Bauchwassersucht) führen.
Einen eigentümlichen Verlauf besitzt die Entzündung der P.
(Pylephlebitis). Dieselbe hemmt durch Gerinnselbildung und Verstopfung des
Gefäßes den Blutabfluß aus der P. oder hebt ihn ganz auf, führt zu Leberabscessen und endet stets tödlich.
Pforten, im Schiffbau die durch thürartige Klappen, «Ober- und Unterpforten», verschließbaren
Öffnungen in Schiffswänden. Man unterscheidet Geschützpforten (für die
Geschützrohre), Kohlenpforten zum Einnehmen der Kohlen in die
Bunker (s. d.), Ladepforten für die Ladung.
Pförten, Stadt im Kreis Sorau des preuß. Reg.-Bez. Frankfurt, am
Pförtener See, Sitz eines Amtsgerichts (Landgericht Guben), hat (1890) 992 E.,
darunter 103 Katholiken, Post und Telegraph. Nahebei Schloß P., in der
Standesherrschaft P., mit 414 E. und dem 1758 auf Befehl Friedrichs d. Gr. zerstörten, größtenteils neu aufgebauten
↔ Schloß des Grafen Brühl, mit kath. Kapelle, Park, Fasanerie und Lustgarten.
Pförtner, die Mündung des Magens (s. d.) in den
Dünndarm.
Pforzheim. 1) Amtsbezirk im bad. Kreis Karlsruhe, hat (1890) 64503 E. in 33 Gemeinden. –
2) P., der Sage nach Porta Hercyniae, Hauptstadt des Amtsbezirks P., am nördl. Fuße
des Schwarzwaldes, am Zusammenfluß der Wurm, Nagold und Enz, an den Linien Karlsruhe-Mühlacker der Bad.,
P.-Wildbad (22,7 km, Enzbahn) und P.-Horb (69,6 km) der Württemb. Staatsbahnen, Sitz des Bezirksamtes, eines
Amtsgerichts (Landgericht Karlsruhe), einer Reichsbanknebenstelle und Handelskammer, hatte 1861: 13854,
1890: 29988 (14567 männl., 15421 weibl.) E., Postamt erster Klasse mit Zweigstelle, Stadtpostagentur, Telegraph,
Fernsprecheinrichtung, Schloßkirche (12., 13. und 16. Jahrh.) mit Grabdenkmälern der ältern fürstl. Familiengruft und dem
1834 von Großherzog Leopold errichteten Denkmal der 400 Pforzheimer (s. unten), Überreste eines alten Schlosses,
vormals Residenz der Markgrafen von Baden-Durlach, stattliches Rathaus, 1892–95 neu gebaut, prächtiges Postgebäude,
neue Kunstgewerbeschule und schönes Museum.
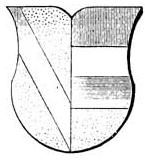
Textfigur:
Von Unterrichtsanstalten bestehen ein Gymnasium, eine Real-, höhere Mädchen-, Kunstgewerbe-, Gewerbe- und
Frauenarbeitsschule, ferner eine Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke. Hauptindustrie ist die Fabrikation von
Goldwaren (s. d.), Silber- und Bijouteriewaren, die (1891) in 460 Fabriken 10430 Arbeiter beschäftigte
und 6000 kg Gold, 21600 kg Silber im Werte von 20 Mill. M. verarbeitete. Außerdem bestehen zwei chemische, drei
Maschinenfabriken, Eisenhämmer, Gerbereien und Steinschleifereien, in der Nähe ein Kupferhammer, zwei Papierfabriken,
eine große Leinwandbleiche, Öl- und Schneidemühlen. Wichtig ist der Holzhandel, der mittels Enz und Neckar bis nach
Holland geht, sowie der Öl-, Frucht-, Wein- und Viehhandel. P. ist der Geburtsort Reuchlins. P. war 1535–65 Residenz der
Markgrafen von Baden-Durlach. Berühmt ist die That der 400 Pforzheimer, die nach dem Siege Tillys bei Wimpfen
(6. Mai 1622) die Flucht des Markgrafen Georg Friedrich dadurch ermöglicht haben sollen, daß sie sich, um den Feind
aufzuhalten, in einem Engpasse dem Tode weihten. Indessen ist diese That historisch nicht mit Bestimmtheit festgestellt.
– Vgl. Pflüger, Geschichte der Stadt P. (Pforzh. 1861); Gmelin, Beiträge zur Geschichte der Schlacht bei Wimpfen
(Karlsr. 1880); Näher, Die Stadt P. und ihre Umgebung (Pforzh. 1884); Brombacher, Der Tod der 400 Pforzheimer
(ebd. 1888).
Pfreimd, auch Pfreimt, Stadt im Bezirksamt Nabburg
des bayr. Reg.-Bez. Oberpfalz, Hauptort der
Standesherrschaft Leuchtenberg (s. d.), an der
Mündung der Pfreimt in die Naab und der Linie Regensburg-Hof der Bayr. Staatsbahnen, hat (1890) 1502 kath. E.,
Postexpedition, ein Schloß, Franziskanerhospital mit der Gruft des Landgrafen von Leuchtenberg; Tuchweberei.
